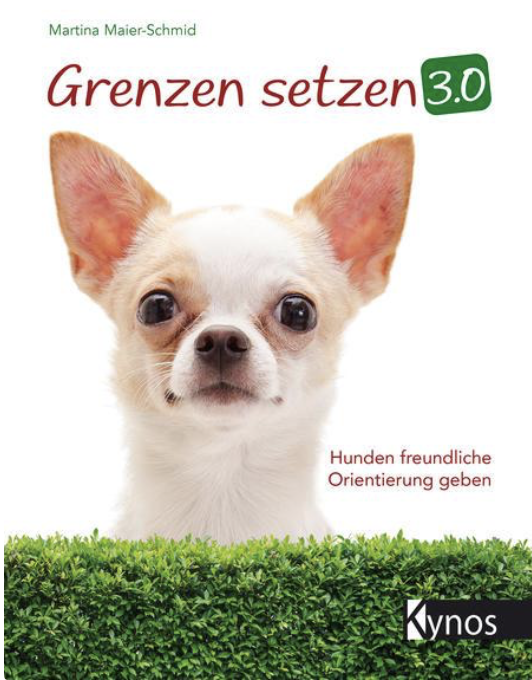Bis hierher und nicht weiter...? Das Ding mit den Grenzen in der Hundeerziehung.
Jede:r Hundehalter:in kennt das Thema: wie sage ich meinem Hund, dass er etwas nicht darf. Trotz vieler Diskussionen darum fehlen jedoch oftmals Definitionen und Erklärungen, um überhaupt auf derselben Ebene miteinander zu sprechen. Martina Maier-Schmid macht sich Gedanken, was Grenzen eigentlich bedeuten, warum das Thema so wichtig ist und wie man Grenzen setzen kann.
Was bedeutet denn Grenzen setzen?
Wenn Hundehalter:innen sich mit dem Thema Grenzen setzen beschäftigen, geht es in der Regel immer darum, dass der Hund etwas tut, was dem Menschen nicht gefällt. Mit anderen Worten kollidiert das Verhalten des Hundes mit den Bedürfnissen seiner Menschen. Ein Hundehalter mag z. B. aus hygienischen Gründen keinen Hund auf dem Sofa und stellt deshalb die Grenze auf, dass der Hund nicht auf das Sofa gehen darf. Hier wird also eine Grenze gesetzt, um die Bedürfnisse des Menschen zu sichern.
Grenzen gegen Allmachtsfantasien?
Immer wieder spielt auch die Angst hinein, dass fehlende Grenz-setzung dazu führen wird, dass die Hunde ihren Menschen auf der Nase herumtanzen werden oder gar aggressiv werden können. Befeuert wird diese Angst durchaus auch immer noch durch Ausbildungskonzepte, die propagieren, dass es in der Mensch-Hund-Beziehung wichtig sei, dass der Mensch ranghöher, der Chef sein müsse und der Hund sich unterzuordnen habe. Es kann – vor allem als unerfahrene:r Hundebesitzer:in – schwer sein, sich dem zu entziehen, wenn es einem immer wieder als Wahrheit von Fachleuten und erfahrenen Hundebesitzer:innen begegnet. Es schafft Angst und Unsicherheit und schafft so immer wieder eine Bereitschaft, sich auf Training einzulassen, das sehr strafbasiert ist und über Verhaltenshemmung funktioniert.
Bedürfniskonflikte  Ob der Hund mit auf das Sofa darf, entscheidet der Mensch mit seinen Bedürfnissen. Foto: ksuksa – stock.adobe.com
Ob der Hund mit auf das Sofa darf, entscheidet der Mensch mit seinen Bedürfnissen. Foto: ksuksa – stock.adobe.com
Bleiben wir bei dem Beispiel, dass ein Mensch es nicht mag, dass der Hund auf das Sofa darf. Sein Hund wiederum findet das Sofa als weichen, warmen, gemütlichen und schön nach Mensch duftenden Liegeplatz unwiderstehlich. Daraus entsteht ein Konflikt zwischen den Bedürfnissen des Hundes und den Bedürfnissen des Hundehalters, der irgendwie aufgelöst werden muss. Für eine Klärung gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Der Hundehalter könnte, wie es auch häufig passiert, mit dem Hund schimpfen, wenn er ihn auf dem Sofa liegend findet oder wenn der Hund auf dem Weg zum Sofa ist. Er könnte ihn vom Sofa runterziehen, etwas nach dem Hund werfen, wenn er auf dem Sofa liegt usw. Eine andere Herangehensweise wäre es, dass der Hund schlicht lernen darf, dass er woanders ebenfalls komfortabel liegen und einen Großteil der Bedürfnisse warm, gemütlich, weich und schön nach Mensch duftend befriedigen kann. Das kann direkt auf dem Boden am Sofarand sein, das kann in einer besonders gemütlichen Liegestelle sein, das kann ein direkt an das Sofa angestellter Sofahocker sein, den nur der Hund benutzt oder was auch immer der jeweiligen Familie an kreativen Möglichkeiten einfällt. Wie gut der Hund die Alternativen annehmen kann, wird damit zusammenhängen, wie groß sein Bedürfnis nach dem Sofaplatz ist und wie gut die dazugehörigen Menschen es dem Hund beibringen, dass er woanders liegen kann.
Wie gut es ihnen gelingt, die Bedürfnisse des Hundes zu berücksichtigen, hat nichts mit Dominanz oder Rangordnung zu tun. Und ich würde immer den zweiten Weg bevorzugen, warum das so ist, wird später noch deutlich werden.
Einschränkungen bewirken Frust
Wenn Bedürfnisse nicht ausgelebt werden können, führt dies zu Frustration. Selbstverständlich gehört ein gewisses Ausmaß an Frustration zum Leben und es ist sicher auch nicht möglich und auch nicht das Ziel, Frustration immer zu vermeiden. Wie stark ein Hund durch eine Einschränkung frustriert wird, hängt zum einen damit zusammen, wie stark das Bedürfnis ist, das hinter dem begrenzten Verhalten steckt.
Zum anderen wird die Frustration steigen, je mehr Bedürfnisse durch Einschränkungen und Begrenzungen des Menschen nicht befriedigt werden können. Ein Hund, der z. B. zuhause im Gang bleiben muss, draußen immer an der Leine gehen muss, kein Mauseloch ausbuddeln darf, nicht an Urinstellen oder anderen spannenden Stellen schnüffeln darf, nicht über Urinstellen markieren und danach scharren darf, wenig Hundekontakte haben darf, für Essen immer vorher eine Leistung erbringen muss, nur dahin gehen darf, wohin der Mensch ihn schickt, nie Kuscheleinheiten oder Spieleinheiten mit dem Mensch einleiten darf usw. wird aller Wahrscheinlichkeit nach viel Frustration empfinden. Hohe Frustration ist sehr häufig eine Grundlage für die Entstehung von hyperaktivem, jagdlichem oder aggressivem Verhalten.
Grenzen müssen individuell sein
Bleiben wir wieder beim Beispiel mit dem Sofa: alle genießen es, gemeinsam auf dem Sofa zu kuscheln, dann darf das auch gelebt werden, solange niemand Drittes geschädigt wird. Hier ist es nicht sinnvoll, eine einschränkende Regelung um ihrer selbst willen aufzustellen. Hier gibt es dann eine erlaubnisgebende Regel, dass der Hund jederzeit auf das Sofa gehen darf. Wenn es einem Hund auf dem Sofa viel zu schnell warm wird, wird dieser durch die Erlaubnis auf das Sofa kommen zu dürfen, nicht zwingend glücklich werden. Schon gar nicht, wenn er auf dem Sofa ausharren soll, weil die Menschen gerne noch die Sofakuschelzeit mit ihm genießen mögen. Dieses Beispiel macht noch mal sehr deutlich, dass Regelungen, die für alle Mensch-Hund-Familien gelten, nicht sinnvoll und hilfreich sind, sondern immer individuell festgelegt werden müssen, weil sowohl die Bedürfnisse der Hunde als auch die der Menschen eben unterschiedlich sind.
Grenzen müssen berechenbar sein
Ganz wichtig ist es auch, dass Regeln, die aufgestellt werden, für den Hund berechenbar und einschätzbar sind. Es ist für einen Hund nicht nachvollziehbar, wenn er ein Mal im Bett schlafen darf und ein anderes Mal dafür bestraft wird. Ein Hund, der nie weiß, ob er ein Verhalten zeigen darf oder nicht, gerät durch diese Erwartungsunsicherheit in einen enorm hohen Stress mit all den bekannten möglichen Nebenwirkungen.
Gibt es vielleicht schon mehr Grenzen im Alltag, als wir denken?
Bereits im täglichen Miteinander bestimmt der Hundehalter über etliche Belange des Hundes. In aller Regel bestimmt der Mensch, wann der Hund etwas zu essen bekommt, ob es eine oder mehrere Mahlzeiten am Tag gibt und mit welchem Futter bzw. mit welchen Nahrungsmitteln der Napf gefüllt ist. Der Mensch entscheidet, wann und wie oft Gassi gegangen wird, wie lange die Gänge dauern, was auf den Spaziergängen gemacht wird und wie häufig der Hund zusätzlich zum Lösen raus darf. Auch wohin die Spaziergänge führen, ob der Hund frei laufen oder an der Leine gehen muss, ob er unterwegs zu anderen Hunden Kontakt haben darf bzw. muss, entscheidet meist der Mensch. Der Mensch entscheidet darüber, welche Beschäftigungsmöglichkeiten er dem Hund anbietet. Die Beschaff enheit der Liegeplätze, Ort der Liegeplätze sucht der Mensch aus. Der Mensch entscheidet auch wann und wie lange geruht werden soll. Auch darüber, mit wem der Hund zusammenlebt, entscheidet der Mensch (Katzen, weitere Hunde, Kinder etc.).
Der Mensch entscheidet darüber, wohin der Hund mitgehen soll (Restaurant, Stadtbummel) oder ob und wie lange er alleine zuhause bleiben soll, ob er mit in den Urlaub fährt oder in dieser Zeit von anderen Menschen betreut werden soll. Und der Mensch entscheidet in aller Regel darüber, ob ein Hund kastriert wird oder nicht und ob er sich fortpflanzen darf oder nicht. Viele dieser Grenzsetzungen ergeben sich einfach aus den Alltagsstrukturen des Hundehalters und den Anforderungen von Familie und Beruf, kombiniert mit den eigenen Bedürfnissen des Hundehalters. All diese Einschränkungen begrenzen die Selbstbestimmung des Hundes. Sie lassen ihm bedingt Spielraum das zu machen, wozu er Lust hat und was er braucht, um zufrieden und ausgeglichen zu sein. Hilfreich ist es, wenn es Möglichkeiten gibt, zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen einen Ausgleich zu finden.
 Ein Nein hilft dem Hund nicht zu lernen, wie man dorthin kommt, wo man hinmöchte. Foto: Daniel Hohlfeld – stock.adobe.comHeißt Grenzen setzen „Nein“ sagen?
Ein Nein hilft dem Hund nicht zu lernen, wie man dorthin kommt, wo man hinmöchte. Foto: Daniel Hohlfeld – stock.adobe.comHeißt Grenzen setzen „Nein“ sagen?
Das Wort „Nein“ hat für uns Menschen eine Bedeutung, diese ist dem Hund allerdings nicht automatisch bekannt. Ein Hund spricht kein „Mensch“, er hat kein genetisch fixiertes Wissen darüber, was Nein bedeutet. Oft bedeutet Nein sehr viele unter-schiedliche Dinge. Nein bedeutet: „Friss den Kothaufen nicht“, in der nächsten Situation bedeutet es: „Spring nicht hoch“. In wieder einer anderen Situation bedeutet es: „Hör auf zu bellen“ oder „Zernage den geklauten Schuh nicht“. Aus Hundesicht sind das wiederum sehr unterschiedliche Verhalten, die nichts miteinander zu tun haben. Der Hund kann nicht automatisch wissen, womit genau er aufhören soll und wie er das machen kann und was er stattdessen tun kann. Im Grunde wäre es viel eff ektiver, dem Hund am Kothaufen zu sagen: „Wir gehen weiter“, bei der Begegnung mit Menschen zu sagen: „Setz dich hin“, ihm zu sagen: „Sei still“ und „Spuck den Schuh aus“. Wenn ein Nein, das nie als Signal aufgebaut und eingeführt wurde, eine Wirkung auf den Hund hat, rührt das daher, dass es meist unfreundlich oder sogar sehr barsch ausgesprochen wird und/oder mit einer bedrohlichen Körperhaltung des Menschen einhergeht. Und oft genug führt es nicht dazu, dass der Hund dauerhaft sein Verhalten ändert, sondern es kurz unterbricht und dann ggf. erneut damit beginnt oder ein anderes Verhalten zeigt, das auch wieder nicht erwünscht ist. Mit einer Information, welches Verhalten gewünscht ist, wird das unerwünschte Verhalten begrenzt, indem es gar nicht erst auftreten kann. Eine sehr effektive Form der Grenzsetzung.
Warum brauchen wir Grenzen?
Eine spannende Frage ist, ob es vielleicht nicht auch eine Frage des Blickwinkels ist, ob man das Gefühl hat, dass es wichtig ist, jetzt Grenzen zu setzen. Ein bisschen kommt es wohl auch auf den eigenen Blickwinkel an, wenn es um das Thema Grenzen setzen geht. Wenn die Konzentration darauf liegt, unerwünschtes Verhalten zu verändern, warten viele Menschen ab, bis unerwünschtes Verhalten vom Hund gezeigt wird, um dann klarzustellen, dass das nicht gewünscht ist. Sie setzen also dann eine Grenze, schränken ein. Grundsätzlich könnte man sich ja aber auch von der anderen Seite dieser Grenze oder dem Übergang zwischen aus Menschensicht erwünschtem und unerwünschtem Verhalten nähern. Denn immer bevor ein Hund unerwünschtes Verhalten zeigt, gibt es noch den Moment, in dem er noch Verhalten zeigt, das akzeptabel ist. Konzentriert man sich darauf, erwünschtes Verhalten zu verstärken, zu belohnen, wird ein Hund automatisch dieses Verhalten häufiger zeigen. Damit wird unerwünschtes Verhalten von selbst weniger. Vor diesem Hintergrund macht es einen großen Unterschied, wie wir unsere Trainingsziele formulieren. Formulierungen wie z. B.
- er – also der Hund – soll nicht an der Leine ziehen
- er soll nicht hochspringen
- er soll nicht bellen
verleiten unweigerlich dazu, darauf zu warten, bis dieses Verhalten gezeigt wird, um es dann zu unterbinden. Sprache formt Vorstellungen und Bilder in unserem Kopf. Der Hund soll nicht ziehen löst eher die Vorstellung eines ziehenden Hundes aus, die dann durchgestrichen werden muss. Der Hund soll nicht hochspringen löst das Bild eines hochspringenden Hundes aus, das dann quasi durchgestrichen wird. Formuliert man die Trainingsziele so, dass sie das Verhalten beschreiben, das man vom Hund sehen möchte, also z. B.
- er soll an lockerer Leine gehe
- er soll mit vier Pfoten auf dem Boden bleiben
- er soll still sein
verändert sich unser Blickwinkel, unser Fokus. Die Formulierungen machen deutlich, was wir von unserem Hund möchten. Sie öffnen damit erst den Blick dafür, dieses Verhalten überhaupt wahrzunehmen, solange der Hund es von sich aus noch zeigt. Und wenn das Verhalten als Leistung des Hundes – und nicht mehr als Selbstverständlichkeit – wahrgenommen wird, kann es auch vom Menschen belohnt werden. Denn es gibt immer den Moment, wo der Hund noch an lockerer Leine läuft , noch alle vier Pfoten auf dem Boden hat oder still ist.
Grenzen setzen ganz praktisch!
Prioritäten definieren Alternativverhalten kann zur Gewohnheit werden. Foto: Ariane Ullrich
Alternativverhalten kann zur Gewohnheit werden. Foto: Ariane Ullrich
Wenn ein Hund einzieht, ist es sinnvoll, dass sich Hundehalter:innen überlegen, was ihnen im Zusammenleben mit ihrem Hund wichtig ist. Und dabei steht die Frage im Mittelpunkt: Welches Verhalten möchten sie in welchen Situationen von ihrem Hund erwarten, was brauchen sie ganz individuell für ihre Lebenssituation. Und dann gilt es, zu überlegen, welches Verhalten wie aufgebaut werden kann. Und es gilt, zu überlegen, was gleich zu Anfang wichtig ist und was noch ein wenig Zeit hat, denn es ist nicht möglich, dass alles auf einmal gelernt werden kann.
Gewohnheiten
Und es kann hilfreich sein, dass bestimmte Anforderungen immer gleich gehandhabt werden, so dass sich Gewohnheiten bilden. Ein Hund soll lernen, an der Haustür zu warten, damit sein Mensch erst überprüfen kann, ob alle gemeinsam sicher rausgehen können. Der Einstieg kann sein – Hand auf die Klinke legen, Sitz sagen (das sollte der Hund schon können), er setzt sich und die Tür geht auf. Im Lauf der Zeit setzt sich der Hund von selbst ab, wenn die Hand zur Türklinke geht, weil er eben weiß, dass das immer so ist, es ist zur Gewohnheit geworden, zur Routine.
 Ein Türgitter kann helfen, Freiraum zu schaffen und Stress zu reduzieren. Foto: Yulia – stock.adobe.comManagement
Ein Türgitter kann helfen, Freiraum zu schaffen und Stress zu reduzieren. Foto: Yulia – stock.adobe.comManagement
Es gibt Verhalten, das schlicht gefährlich ist für den Hund selbst, für andere Tiere oder andere Menschen oder auch den eigenen Mensch. In diesem Fall ist es zielführend, über sinnvolle vorausschauende Managementmaßnahmen zu verhindern, dass das Verhalten auftreten kann. Zum Schutz aller Beteiligter. Das bedeutet nicht, dass nie daran gearbeitet wird, dass der Hund dieses Verhalten ändert, aber es verschafft Luft, dies in Ruhe und wohlüberlegt zu machen.
Menschen denken oft , wenn sie Managementmaßnahmen ergreifen, würden sie sich nicht ausreichend ihrem Hund gegenüber durchsetzen. Das löst dann schnell Minderwertigkeits- oder Versagensgefühle aus. Dabei spricht es für kluges, umsichtiges, planvolles, Grenzen setzendes Handeln, wenn Management eingesetzt wird, um unerwünschtes Verhalten nicht aufkommen zu lassen und parallel kleinschrittiges Lernen zu ermöglichen und/oder Gefahrenquellen zu vermeiden. Es nimmt Druck und Stress und hilft so, das Training sinnvoll aufeinander aufbauend anzugehen.
Unterbrechen von Verhalten
Eine weitere Kategorie ist, dass Verhalten unterbunden werden soll, das jetzt gerade aktuell stört, aber nicht grundsätzlich verboten ist. Unterbrochen wird das in dieser bestimmten Situation gerade nicht passende Verhalten durch die Aufgabe, etwas anderes zu zeigen, was der Hund schon kann, zu seinem aktuellen Aktivitätslevel und seiner aktuellen Motivation passt. Wenn ein Hund noch kaum ein anderes Verhalten zuverlässig kann, regelt man die Situation für den Übergang des Übens durch Management. Ich leine bei Sichtung des Güllefeldes den Hund an und gehe mit ihm daran vorbei.
Grenzen setzen durch Strafe nötig?
Nun bleibt also die Frage zu klären, ob man im Leben mit Hunden ganz ohne Verhaltenshemmung auskommen kann. Verhalten zu hemmen bedeutet, dass Verhalten seltener, weniger intensiv, gar nicht mehr auftritt. Hundeverhalten über Verhaltenshemmung wirksam zu steuern, ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Es müssen etliche Regeln eingehalten werden:
- Das Verhalten muss immer unterbrochen werden. Wenn das nicht so ist, lernt der Hund, dass er ab und zu das Verhalten doch zeigen kann. Er lernt z.B. sehr schnell, dass wenn der Mensch noch außerhalb der Wurfweite ist, er den gefundenen Kothaufen durchaus verspeisen kann. Eine verhaltenshemmende Maßnahme muss angekündigt werden, damit der Hund langfristig die Chance hat, sich in seinem Tun zu unterbrechen und etwas anderes zu machen. Und dafür wiederum muss er mindestens ein anderes Verhalten vorher gelernt haben, dass er dann zeigen kann. Es wäre also u.U. der kürzere Weg, dem Hund am Kothaufen gleich ein Sitz zu sagen, statt vorher etwas nach ihm zu werfen.
- Es kann Nebenwirkungen haben durch falsche Verknüpfungen. Es kommt sehr häufig vor, dass der Schreck, der Schmerz, der Frust mit anderen Reizen, die gleichzeitig in der Situation da sind, in der das Verhalten auftritt, verknüpft wird. Ein Hund, der an einen Weidezaun kommt und sich vom Stromschlag erschrickt, hat häufig Angst vor den Tieren hinter dem Zaun oder manchmal auch vor dem Ort und nicht zwingend vor dem Zaun.
- Es kann Auswirkungen auf die Beziehung haben. Wird der Bindungspartner, also der Mensch, mit Schmerz oder Schreck in Zusammenhang gebracht, kann das Vertrauensverlust und Unsicherheit zur Folge haben. Vor allem, wenn der Hund nicht verstanden hat, worum es dem Menschen hier geht.
- Die Strafe muss dem individuellen Hund angepasst sein. Alle Bestrafungsmöglichkeiten können in einem Kontinuum zwischen sehr mild und nebenwirkungsarm und extrem aversiv und nebenwirkungsträchtig eingeordnet werden. Dabei ist es sehr vom individuellen Hund abhängig, was dieser als wenig beeindruckend, mild aversiv empfindet und was er als sehr erschreckend/unangenehm, extrem aversiv empfi ndet. Das bedeutet, wenn man Grenzen über Verhaltenshemmung, also über aversive Reize setzen möchte, muss man sich als Hundehalter sehr genau mit den Regeln für Bestrafung beschäftigen und damit, welche Reize vom eigenen Hund wie stark empfunden und bewertet werden. Zusätzlich sollte man ein Verhalten aufbauen, das man dann anschließend abrufen möchte. Im Grunde ist das auch nicht weniger aufwendig, als sich darüber Gedanken zu machen, wie man erwünschtes Verhalten gut aufb auen kann, welches man wirklich für das Zusammenleben mit seinem Hund braucht und wie man das mit den Bedürfnissen des eigenen Hundes in Einklang bringt.
Unterbrechen mit einem anderen Signal  Eine gute Bindung besteht vor allem auch aus Vertrauen und Sicherheit. Foto: Cristina Conti – stock.adobe.com
Eine gute Bindung besteht vor allem auch aus Vertrauen und Sicherheit. Foto: Cristina Conti – stock.adobe.com
Jedes gut aufgebaute Signal kann unerwünschtes Verhalten unterbrechen, sofern der Hund es in diesem Moment noch ausführen kann. Ein gut trainierter Rückruf, dessen Belohnungen sich an den Bedürfnissen des Hundes orientiert haben, bricht Verhalten ab, wenn der Hund dem Reh hinterhergeht, einer Spur nachschnüffeln möchte oder den Hundekumpel begrüßen möchte. Ein gut aufgebautes Stoppsignal kann helfen, um Verhalten zu unterbrechen.
Zusammenfassend gesagt:
„Grenzen setzen ist schlussendlich Lernen. Hinterfragen Sie deshalb immer sehr genau, was jemand genau meint, wenn er davon spricht, dass es nötig sei, dem Hund Grenzen zu setzen und prüfen Sie gut, über welche Einwirkungen und Vorgehensweisen diese Grenzen gesetzt werden sollen.“
– aus „Grenzen setzen 3.0“, Kynos-Verlag