Coaching-Trap - Die eigene Kommunikation überprüfen
Trainer:innen möchten nicht nur beim Hund Verhaltensänderungen bewirken, sondern auch bei deren Bezugspersonen. Doch was, wenn der bzw. die Hundehaltende es einfach nicht schafft, die Anregungen des Trainers bzw. der Trainerin im Alltag umzusetzen? Dr. Sebastian Altfeld erläutert, wie das heuristische Modell der Kompetenzentwicklung aus dem Leistungssport auch Hundetrainer:innen im Umgang mit ihren Kunden helfen kann.
Im Trainingsprozess ist es wichtig, dass sich der/die Hundehalter:in im Verhalten anpasst und den Lernerfolg in der Stunde und zuhause fortführt. Doch genau hier liegt manchmal das Problem. Woran könnte das liegen? Dazu soll dieser Artikel Informationen bieten. Er orientiert sich am Modell von Altfeld und Linz (2023), die in ihrem Artikel in der Zeitschrift „Leistungssport“ ein Modell erläutern, wie Sporttrainer:innen gezielter auf ihre Athlet:innen eingehen, um die Wahrscheinlichkeit für die Verhaltensänderung zum gewünschten, zielführenden Verhalten zu erhöhen. Und wieso sollte man sich nicht aus anderen Bereichen etwas abschauen?
Kompetenzentwicklung
In einer wie oben beschriebenen Situation ist es erst mal verständlich, wenn man als Trainer:in ärgerlich wird. Wieso macht die Person nicht das, was ich ihr gesagt habe? Vielleicht macht sie das mit Absicht? Oder ist die Person unfähig?
An dieser Stelle sollte eher überprüft werden, ob die Art der Vermittlung zur Stufe der Person gepasst hat. Denn das Zeigen eines anderen Verhaltens (also das Ausbleiben des gewünschten Verhaltens aus Trainer:in-Sicht) durch einen/eine Hundehalter:in ist ein Hinweis darauf, dass hier genauer hingeschaut werden sollte – und dazu kann das nachfolgende Modell eine Idee bieten. Das heuristische Modell zur Kompetenzentwicklung (Abbildung Seite 33) ist eine Zusammenführung der Überlegungen aus zwei Modellen, dem Modell der Kompetenzstufenentwicklung (Broadwell, 1969) und dem Transtheoretischen Modell von DiClemente und Prochaska (1982). Es soll Trainer:innen eine Orientierungshilfe im Umgang mit Klient:innen im Aufbau langfristiger Verhaltensänderungen bieten. Das Modell besteht aus fünf Stufen, die in der Abbildung auf Seite 33 dargestellt sind.
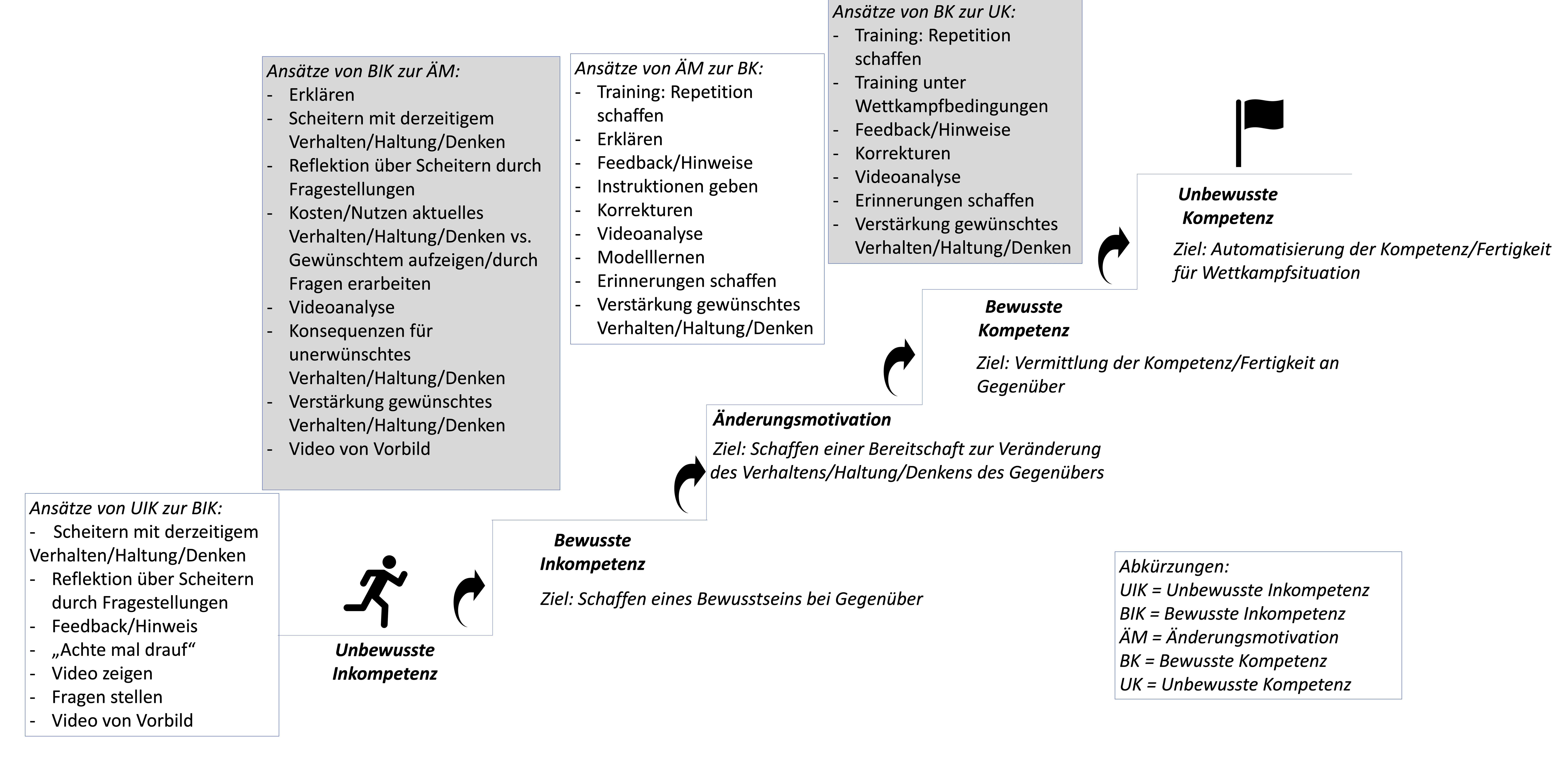
Die 5 Stufen
Fangen wir auf der rechten Seite des Modells an. Die oberste Stufe stellt das allgemeine Ziel dar: Die ‚unbewusste Kompetenz‘ steht für das automatisierte Nutzen der gewünschten Verhaltensweise. Das gewünschte Verhalten des Halters/der Halterin, beispielsweise das konsequente Weitergehen beim Spazierengehen, wird in den Alltag voll integriert. Auf der Stufe der ‚bewussten Kompetenz‘ weiß das Gegenüber, was sie bzw. er tun soll, braucht aber noch eine hohe Bewusstheit, um das gewünschte Verhalten abzurufen. Es kommt folglich immer wieder zum Zeigen des alten Verhaltens, weil der neue Ansatz einfach „vergessen“ wurde. Er ist noch nicht automatisiert. Gerade in Stresssituationen und in Zuständen starker Ermüdung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass in der Kompetenz-Erwerbphase alte Verhaltens- oder Denkmuster auftauchen.
Die Stufe der ‚Änderungsmotivation‘ stammt aus Überlegungen von DiClemente und Prochaska. Sie gehen davon aus, dass eine Person erst eine Bereitschaft für Veränderung haben muss, damit diese eintritt. Sprich, das neue Verhalten, die neue Denkweise oder Haltung muss für die Bedürfnisse und Ziele der Person mehr Vorteile als Nachteile haben als das alte Verhaltensmuster. Diese Überlegung ist immens wichtig. Oftmals wird davon ausgegangen, dass wenn dem Gegenüber ein aus Trainer:in-Sicht fehlerhaftes Verhalten aufgezeigt und korrigiert wird, automatisch eine Bereitschaft für Veränderung und Aufgreifen des neuen Verhaltens gegeben ist. Dies gilt für den Sport- und auch für andere Bereiche, in denen Menschen anderen etwas beibringen wollen. Dem ist aber nicht so, da dem Gegenüber vielleicht gute Gründe einfallen, wieso das alte Verhalten viel sinnvoller zu sein scheint. Durch das Aufzeigen des „falschen“ Verhaltens wird zunächst nur die zweite Stufe des Modells, die ‚bewusste Inkompetenz‘, erreicht. Es besteht jetzt ein Problembewusstsein (nach DiClemente & Prochaska, 1982) darüber, dass es eine Diskrepanz zwischen dem aktuellen Verhalten und der Sicht des Trainers/der Trainerin gibt. Die Anfangsstufe nennt sich ‚unbewusste Inkompetenz‘ und besagt, dass die Person kein Bewusstsein darüber besitzt, dass ihr Verhalten fehlerhaft bzw. nicht hilfreich aus Sicht des Trainers/der Trainerin ist.
Konflikte verhindern
Wozu ist dieses Modell nun hilfreich? Es soll mögliche Konflikte zwischen Trainer:in und Hunderhalter:innen verhindern und Zeit im Trainingsprozess sparen, indem es die Trainer:innen für die Stufen sensibilisiert. Nehmen wir nun zur Erläuterung des Modells das Beispiel mit dem konsequenten Weitergehen beim Spaziergang. Nun ist das Ziel des Trainers/der Trainerin, dass der/die Hundehalter:in dies auch im Alltag jedes Mal durchführt, um den Lernprozess beim Hund zu fördern (unbewusste Kompetenz).
Selbstaufmerksamkeit
Zunächst muss dem/der Halter:in klar werden, dass sie bzw. er dies aktuell nicht macht und stattdessen stehen bleibt oder gar hinter dem Hund herläuft. Und nein! Das ist nicht immer allen sofort bewusst. Jedem passieren Dinge, auf die man hingewiesen werden muss, weil sie einem nicht bewusst sind. Diese bewusste Inkompetenz (aus Trainer:in-Sicht!) ist die Voraussetzung für Veränderung, denn ohne ein Bewusstsein haben Erklärungen und Hinweise keine Wirkung. Um diese Einsicht zu erzeugen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten (siehe Abbildung „Ansätze von UIK zur BIK“). So könnte man als Trainer:in Fragen stellen („Wie haben Sie sich gerade verhalten?“.), um die Selbstaufmerksamkeit zu fördern.
Motivation
Ein Problembewusstsein stellt aber nicht automatisch eine Bereitschaft für Veränderung dar. Dies kennt jeder in Bezug auf gesundes Essen. Viele Menschen wissen, was gesundes Essen ist, entscheiden sich dennoch für andere Angebote. Dies ist im Training manchmal auch so und hier entstehen potenziell Konflikte, die mit der Nutzung des Modells verhindert werden könnten. Woran erkenne ich, dass eine Person keine Änderungsmotivation hat? Wenn die Person beispielsweise eher widerwillig das Verhalten zeigt, zögert oder mit Gegenfragen antwortet. Dies sind wertvolle Hinweise, um nicht dagegenzureden, sondern einen anderen Weg einzuschlagen. Dazu muss kurz Motivation erläutert werden. Sie entsteht durch die Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen des aktuellen bzw. alternativen Verhaltens im Kopf. Diese Auseinandersetzung ist ein unbewusster Prozess, der unser Verhalten im Alltag ständig begleitet: Soll ich bei der Live-Übertragung der Leichtathletik-EM im Fernsehen auf die Toilette gehen oder bleibe ich noch sitzen? Die Motivation für ein Verhalten und die Entscheidung gegen eine andere Verhaltensoption unterliegt diesem unbewussten Abwägungsprozess. Bei der unbewussten Verarbeitung können jedoch fehlerhafte Bewertungen stattfinden, weil die Person aufgrund diverser Ursachen (z. B. begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zur Abwägung aller Argumente, fehlende Präsenz von Argumenten, fehlendes Wissen über Gründe für alternatives Verhalten) nicht alle Aspekte in die Bewertung aufnimmt und sich so für das weniger hilfreiche Verhalten entscheidet.
Mehrwert
Es kann daher wertvoll sein, zu versuchen, die Sichtweise des Hundehalters/der -halterin zu verstehen, ehe dagegen diskutiert wird („Können Sie mir sagen, was der Vorteil ist, wenn Sie hinter dem Hund hergehen?“ „Und was ist der Nachteil, wenn Sie weiter hinterhergehen würden?“). So gibt der/die Halter:in vielleicht an, dass er/sie die Erfahrung gemacht hat, dass der Hund zuhause dann doch immer kam. Und auf der anderen Seite ein Schuldgefühl aufkommt, wenn er/sie weitergeht. Bei dieser Sichtweise ist erst mal verständlich, wieso die Person zögert, das neue Verhalten anzunehmen. Nun hat der/die Trainer:in die Möglichkeit, gezielte Informationen zu geben oder den Blick durch weitere Fragen („Könnte Ihr aktuelles Verhalten auch Nachteile haben?“) zu weiten, um eine bewusste Entscheidung für das eine oder andere zu treffen. Das Ziel des Trainers/der Trainerin ist an dieser Stelle, den Mehrwert für das alternative Verhalten herauszustellen und die Nachteile für das aktuelle Verhalten bewusst zu machen. Dazu gibt es erneut unterschiedliche Ansätze und Methoden (siehe Abbildung). Dieses Vorgehen kostet mehr Zeit, der/die Trainer:in bekommt aber einen besseren Einblick und wird somit im Handeln flexibler.
Wiederholen und automatisieren
Ist der/die Hundehalter:in nun auf der Stufe der Änderungsmotivation angekommen, gilt es, dass gewünschte Verhalten zu wiederholen und zu automatisieren. Doch auch auf dieser Stufe kann das Verhalten ausbleiben. Dies liegt nun nicht mehr daran, dass die Person nicht möchte, sondern oft daran, dass das neue Verhalten schlicht vergessen wird. In solchen Momenten braucht es als Trainer:in methodisch die Korrektur als Erinnerung und das Schaffen von Erinnerungen an sich (z. B. Zettel, Symbole auf dem Arm als Anker, die Frage „Wie denken Sie daran?“). Leider reagieren Trainer:innen auf dieser Ebene auch mit Konsequenzen (z. B. Ärgerreaktion) für das Ausbleiben des gewünschten Verhaltens, obwohl Konsequenzen nur einen Effekt haben, wenn es um die Schaffung von Änderungsmotivation geht. Die Bereitschaft für Veränderung ist auf dieser Ebene aber da, nur fehlt vielleicht die Fertigkeit, das neu erworbene Wissen in dem Moment abzurufen, wenn es gefordert ist. Daher könnten Konsequenzen auf dieser Ebene zu Frust und kontraproduktiven Effekten führen (z. B. Angst vor Fehlern).
Werden die passenden Methoden gewählt, so kann man gemeinsam das Ziel erreichen und eine Veränderung im Alltag umsetzen. Dies dient dann dem Hund, der durch klare Signale Orientierung und Sicherheit erhält. Doch dafür muss zunächst das Verhalten bei Herrchen bzw. Frauchen passend verändert werden.




